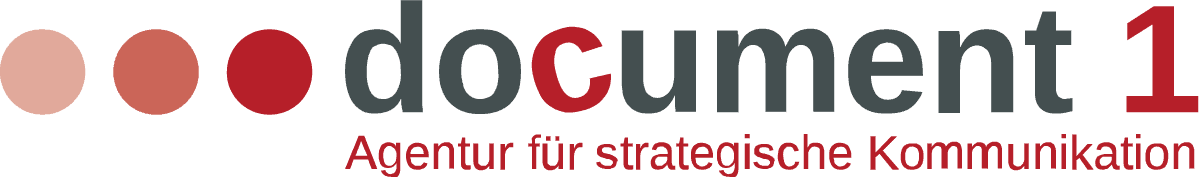„Der Mensch dahinter“: Das Portrait gewinnt zunehmend an Beliebtheit in journalistischen Kreisen. Die Gefahr könnte darin bestehen, dass sich Journalisten in eine Art Pressesprecher des Portraitierten verwandeln, wenn sie eine Sammlung selbstreferenzieller O-Töne veröffentlichen. Wir wollen diese Verwandlung verhindern. Und klären über vier Irrtümer auf:
- Irrtum: Das Portrait ist des Lesers Liebling
Laut Leserforschung sind das Thema und der Wiedererkennungseffekt entscheidend für gute Quoten. Dass Leser am liebsten Portraits lesen, ist also ein Irrtum. Es hängt ausschließlich am Thema, ob dem Leser dazu eine Grafik, ein Text mit Fakten oder ein Portrait serviert wird. Sind Protagonisten wichtiger als Fakten, dann eignet sich eher ein Portrait.
- Irrtum: Jeder Mensch verdient sein eigenes Portrait
So hart es klingt: Menschen mit einer normalen Vita sind nicht interessant und erreichen keine besonders hohe Quote. Gefragt sind Urtypen, an denen sich ein Portraitautor gut orientieren kann: Berichte über Sisyphos, Odysseus oder Ödipus wecken das Interesse der Leserschaft.
- Irrtum: Ein Portrait ist gleichzusetzen mit einer Kurzbiografie
Weglassen statt Sammeln: Der Verfasser eines Portraits sollte punktgenau herausarbeiten, was an der Vita seines Protagonisten für die Leser relevant sein könnte. Die Biografie ähnelt dem Gemälde, das journalistische Portrait der Karikatur.
- Irrtum: Das Portrait ist eine Darstellungsform
Das Portrait ist keine Darstellungsform, sondern eine Absicht. Denn für das Portrait bietet sich das gesamte Spektrum journalistischer Textformen an: nachrichtlicher Lebenslauf, Feature, Reportage. Es erscheint als Kommentar, als Glosse oder gar als Wortlaut-Interview.
⇒ Zu den ausführlichen Details geht es hier entlang. ⇐